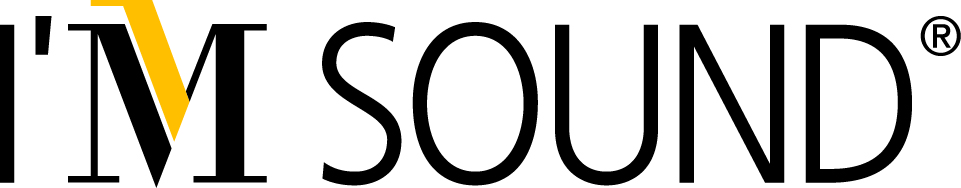I'M SOUND im Gespräch mit Alex Mayr
Es gibt in der deutschsprachigen Popmusik dieser Tage womöglich wenige künstlerische Positionen, die einen ähnlichen Grad an Eigenständigkeit und Originalität erreicht haben wie die, der Wahl-Mannheimerin Alex Mayr. Anlässlich ihres neuen Albums „Park“ haben wir uns mit ihr genau da getroffen, wo die Inspiration für besagtes Album herkommt. Im Mannheimer Luisenpark sprachen wir mit ihr unter anderem übers Anfangen, über Film- und Popmusik, darüber, was sie jungen Frauen in der Musikwelt gerne mitgeben würde und warum sie es cool findet, die neue Markenbotschafterin von I’M SOUND zu sein.
Wir haben uns am Eingang eines Parks getroffen. Enorm passend zu Deinem neuen Album „Park“, das mit dem Song „Eingang“ und der Zeile „Jeder Anfang hat ‘nen Eingang“ beginnt. Nachdem das vorherige Album „Wann fangen wir an?“ betitelt war drängt es sich förmlich auf, mit der Frage nach der Bedeutung von „Anfangen“ für Dich einzusteigen?
Beim ersten Album war das eindeutig zu beantworten. Weil es wirklich sehr lange gedauert hat und erst ein Knoten platzen musste. Deswegen lag es nahe, das Album genau so zu nennen: „Wann fangen wir an?“ Auch so ein bisschen als Frage an mich selbst. Es war ein innerer, aber auch ein äußerer Prozess, weil zunächst andere Leute beteiligt waren. Zu Beginn war ich in dieser Phase für alles Mögliche sehr offen, bin monatlich zu einem Produzenten nach Berlin gependelt und habe irgendwann erst gemerkt, dass es das so einfach nicht ging. Diese ganzen so genannten „Regeln“, die mich unfassbar stören. Dass irgendwelche Akkorde zu komplex seien, ich den Text so umschreiben solle, dass ihn auch die Kids kapieren und so weiter. Ich habe dann irgendwann gesagt: hört zu ich bin jetzt über 30, habe vielleicht andere Themen als die Kids und will die auch gar nicht „mitnehmen“! Dann kam irgendwann tatsächlich der Twist – gepusht auch und gerade von Konstantin Gropper, der mich eigentlich nur bestärkt hat, aber es eben auch formuliert hat. Nämlich: „Du brauchst keinen Produzenten – mach einfach!“ Und das war dann tatsächlich ein neuer Anfang, ein neuer Start für mich. Das war der letzte Schubs Mut, das Selbstbewusstsein, das mir vorher gefehlt hat. Einfach mal auf sich selbst vertrauen. Ich habe mich immer zu sehr beeinflussen lassen auch und gerade von Businessleuten insbesondere im Majorkontext. Am Ende habe ich gar nicht verstanden was die eigentlich von mir wollen. Die sagen ja auch eigentlich nie wirklich etwas, sondern labern oft nur rum und vor allem um eines geht es da irgendwie nie: um Musik. Das ist nicht meine Welt. Seit ich das jetzt vollkommen kompromisslos selbst mache, geht es mir zum einen unfassbar gut und zum anderen stehe ich zu 200% hinter dem, was ich da tue. Das bewirkt dann wiederum, dass es mich eigentlich gar nicht mehr tangiert, wenn irgendwer meine Herangehensweise nicht für die richtige hält. Ja cool, danke – ist aber meine. Das anzufangen war das Beste, was mir passieren konnte.
Das waren jetzt die großen Prozesse. Wie hältst Du es mit dem „Anfangen“ im Alltag? Ist das auch so ein Ausdruck Deiner Arbeitsweise?
Seither auf jeden Fall. Ich fange an und ziehe durch. Vorher habe ich das nicht geschafft oder es hat sich alles ewig gezogen bis mal ein Song fertig war. Alles furchtbar verkopft. Das neue Album ist das beste Beispiel für diese „neue“ Art. Ich habe genau hier an diesem Ort letztes Jahr gespielt, fand den Vibe beeindruckend, hatte die Idee und habe noch an diesem Tag zehn Songtitel aufgeschrieben, erste Textfragmente formuliert, bin heimgefahren und hab gesagt: ich mache jetzt ein Album und es soll „Park“ heißen! Und genau das ist in kürzester Zeit passiert und ich habe es mir bewiesen. Ich habe einfach angefangen und durchgezogen.
Was zum nächsten Schritt überleitet: dem Fertigwerden. Ist ja auch wesentliches Teil des Kunstschaffens.
Das wiederum fällt mir total leicht. Ich weiß, wenn ein Song fertig ist. Ich bin kein Mensch wie beispielsweise Caspar, der dreimal so viele Songs schreibt für ein Album als er braucht und dann die besten auswählt. Das wäre nie meine Arbeitsweise. Ich merke sehr schnell, ob es sich lohnt, etwas zu verfolgen. Es gibt vielleicht drei, vier Skizzen, die ich für „Park“ dann nicht weiterverfolgt habe, aber den Rest habe ich einfach durchgezogen. Und von Konstantin Gropper habe ich gelernt, Perfektionismus abzulegen. Der steckt zwar natürlich in mir, aber ich nehme – insbesondere beim Einspielen – die Dinge nicht mehr alle so genau. Ich würde mich nicht als Gitarristin bezeichnen, aber ich stelle mich halt mit der Gitarre hin und mache. Das ist dann womöglich etwas schräg und untight, aber genau das ist mein Ding geworden. Das macht es am Ende auch einfach aus. Das Gegenteil davon sind viele der klassischen Mainstream Deutschpopproduktionen, die jede Aufnahme bis auf jede einzelne Silbe, jedes Vocal-Takes durchperfektionieren. Ich habe häufig einfach die ersten Takes genommen, weil die einfach die Emotionen getragen haben, die ich wollte – die paar schiefen Töne machen es dann halt irgendwie eher echt als schlecht.
Du sprachst jetzt von Deiner Gitarre. Wie ist denn Deine Beziehung zu Deinem Instrumentarium?
Ich glaube, es gibt zwei Seiten. Eine eher so „mach was ich will“ – die andere „mal sehen was Du so machst“. Es geht aber immer mehr in die Richtung, dass ich mich beispielsweise bewusst ans Klavier setze, weil ich weiß, dass es mich andere Songs schreiben lässt als die Gitarre. Weswegen ich übrigens auch überhaupt erst mit Gitarre angefangen habe. Weil mich das Schreiben am Klavier irgendwann ein bisschen gelangweilt hat. Es wurde doch strukturell alles immer sehr ähnlich und hat mich nicht mehr inspiriert. Ich weiß einfach, dass manche Songs so niemals am Klavier entstanden wären. Zugegeben auch, weil ich am Anfang auch nur 5 Akkorde spielen konnte, aber auch das ist Teil des Prozesses geworden. Aus der eigenen Limitiertheit das Beste herausholen und nicht an zu viel Auswahl scheitern.
In der konkreten Zusammenarbeit mit Deinem Partner Konrad, der ja sozusagen Deine musikalische Rhythmusgruppe ist, steht schon immer erst der Song und nicht auch mal der Beat?
Das ist auch eine eindeutige Entwicklung. Ich mache immer erstmal alles alleine. Auch die Beatidee. In zweiter Instanz gehe ich dann zu Konrad. Auch bezüglich der Texte. Weil er eben ein Spiegel ist, den ich dringend brauche. Aber das ist in sich differenzierter geworden. Wenn er jetzt zum Beispiel irgendetwas „nicht schlüssig“ findet, denke ich da nochmal drüber nach. Wenn ihm jetzt irgendein Wort einfach nicht gefällt, dann eher nicht mehr. Schlagzeugmäßig ist das manchmal eine besondere Situation, mit ihm als Drummer. Weil ich Beats ja eher so midimäßig reinhacke. Wenn das so gar nicht geht, greift er dann mal ein und das ist dann auch meist richtig.
Es gab mal eine Serie in der Spex über die eigene „Kunstsprache“ von Künstler:innen. Glaubst Du, dass Du eine solche hast? Musstest bzw. musst Du für jeden Song eine Sprache suchen oder ist das einfach Deine Art Dich auszudrücken?
Letzteres glaube ich schon. Und auch, dass sich das entwickelt hat über die Jahre. Die Sprache ist schlicht und einfach ganz viel ich. Ich mache mir über diese „Rolle“, von der ja viele sagen, dass man sie ja immer irgendwie habe oder einnehme, wenn man auf der Bühne steht oder Songs schreibt, ganz viele Gedanken, aber ich glaube in meinem Fall einfach nicht an sie. Ich kann das kaum trennen. Ich schreibe sehr autobiographisch und anders kann ich das einfach nicht. Die Idee der Kunstfigur ist mir fremd.
Das führt dann noch zu der Frage nach „Image“ insgesamt, die sich ja vor dem Hintergrund digitaler Repräsentation nochmal ganz anders stellt. Welchen Stellenwert hat Image für Dich?
Es ist mir wichtig, dass man mich richtig verortet. Ich habe zum Beispiel bei diesem Album endlich das Gefühl, dass mich Andere anfangen so zu sehen, wie ich das selbst tue. Ich will da nichts erschaffen. Ich bewege mich aber auch nun mal zwischen Mainstream und Indie und bin sicher keine Independent Frau im klassischen Sinne. Aber ich glaube nun mal, dass mein Sound so eigen ist, dass er für sich steht. Und das sollen die Leute jetzt einfach verstehen! (lacht)
Nun sind die sozialen Medien ein zentraler Kanal, um so etwas zu vermitteln. Wie stehst Du zu diesen Kanälen bzw. zum Verhalten auf ihnen?
Ich versuche schlicht auf sozialen Medien so zu agieren, dass es sich für mich natürlich anfühlt. Ich will aber wirklich nicht dieses Authentizitäts-Thema aufmachen. Es nervt mich eher, dass ständig insbesondere im Deutschpop alle immer und immer wieder betonen, wie authentisch sie alle doch seien. Für mich muss einfach mein Handeln meinem inneren Kompass entsprechen. Und ich merke mittlerweile Gott sei Dank schnell, wenn das nicht der Fall ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich nie in den sozialen Medien für irgendwelche komischen Produkte werben könnte. Gleichzeitig ermöglichen diese Medien grundsätzlich Kontakt zu Leuten und da passiert einfach irrsinnig viel – was direkte Rückmeldungen von Fans angeht. Und das finde ich immer noch schlicht nur cool.
Das wirkt jetzt zugebenermaßen beinahe konstruiert, aber an dieser Stelle muss von uns einfach die Frage kommen, wie sich besagter innerer Kompass und Deine Kompromisslosigkeit dann mit der Tatsache vereinbart hat, neue Markenbotschafterin von „I’M SOUND“ zu werden?
Ich merke zum Beispiel daran ganz einfach auch in mir selbst, wie viel weniger angreifbar ich geworden bin. Weil ich einfach das mache, wohinter ich stehen kann. Ist doch ganz einfach: Eine Versicherung für Musiker:innen. Mega. Warum soll das jetzt nicht gehen? Ist doch supercool! Ehrlich gesagt, sehe ich da so gar kein Problem.
Jetzt drehen wir an dieser Stelle doch mal die Perspektive. Wir haben jetzt über Dich als Absenderin gesprochen. Nun kann man sich 2021 schon fragen, welche „Funktion“ Popmusik und/oder Popkultur gesellschaftlich einnimmt. Wenn man dann einen Song wie „Alle“ von Deinem neuen Album heranzieht, dann könnte man ja schon das große Wort der „Gesellschaftskritik“ bemühen.
Das sind einfach meine Themen. Und gerade dieses Spezielle aus „Alles“ spukt seit einiger Zeit in meinem Leben rum. Weil ich um mich herum einfach sehe, dass es die Leute gibt, die sich da ihr Häuschen bauen und dann diejenigen, die das auch machen, aber bei mir den Eindruck hinterlassen, dass sie sich nie gefragt haben, ob sie das wirklich wollen. Oder, ob sie ihr Leben so leben würden, wenn sie die Wahl hätten – die sie natürlich irgendwie haben – aber ich da einfach eine ganze Menge Herdentrieb und Fremdbestimmtheit sehe.
Lass uns mal über Popmusik im Allgemeinen und Deine im Speziellen sprechen, die Du als „Soundtrackpop“ bezeichnet hast. Ist das das im Sinne von Begleitmusik einer Wirklichkeit oder im Sinne einer Emotionsprägung. Der Soundtrack per se verändert ja durchaus auch die Welt, die wir uns da anschauen. Oder zumindest die Wahrnehmung derselben.
Am Ende entscheiden das ja erstmal die Leute. Bei mir sind es eindeutig beide Ebenen. Dieser Begriff Soundtrackpop kam jetzt erst mal ästhetisch in die Welt, weil ich finde, dass das alles sehr „filmisch“ klingt, durch die strukturelle Vielschichtigkeit der Songs. Das ist dann auch der Moment, in dem Konstatin Gropper und ich uns treffen. Beide aus der Klasssik und dem Orchesterwesen kommend und solche Strukturen liebend.
Dann kann man ja dazu dankbarer Weise den „echten“ Soundtrack zu „Wir können nichts anders“ von Detlev Buck vergleichen, den Du gemeinsam mit Konstantin Gropper geschrieben hast.
So unterschiedlich finde ich den Prozess nicht. Wenn man sich auf sein Unterbewusstsein verlässt und macht, was sich richtig anfühlt. Nur eben, dass im einen Fall noch ein toller Regisseur kommt und vielleicht auch mal sagt, dass er irgendeinen Punkt nicht versteht. Und dann wird es schwieriger, weil wenn man diese ursprüngliche Intuition nochmal überarbeiten muss, es sehr schnell kopfig wird. Da muss man aufpassen. Gerade bei der Titelmelodie ging es ein paar Mal hin und her und wir wurden da beide so ein bisschen verspannt. Das Coole daran ist, dass es einfach trotzdem hervorragend geklappt hat (lacht).
Es ist unabdingbar im Jahr 2021 auch über die Repräsentation insbesondere von Musikerinnen in der Popmusik zu sprechen. Wie ist aus Deiner Perspektive der Status Quo?
Es ist zweifelsfrei immer noch nicht so, wie es sein sollte. Aber, um das mal positiv zu betrachten, glaube ich schon, dass eine Kehrtwende zu erkennen ist. Ich fürchte dennoch, dass es immer noch Jahre dauern wird, bis wir Musikerinnen gleichwertig behandelt/gespielt/gebucht werden. Wo man da ansetzt, bleibt ja auch häufig offen, weil sich alle ständig den schwarzen Peter hin und her schieben. Der Festivalbooker, die Radioleute, die Labelmenschen. Irgendwer braucht halt mal den Mumm zu sagen, dass das jetzt mal anders gemacht wird. Aber das kommt immer mehr.
Das zielte jetzt primär auf die professionelle musikwirtschaftliche Ebene. Wie sieht es denn auf hintergründigeren Ebenen, wie bspw. im Instrumentenhandel aus? Da scheint manchmal schon noch ziemlich klassisches Mansplaining der allgemeine Umgangston.
Das ist richtig. Ich würde auch wirklich gerne erstmal echt gerne viel mehr junge Musikerinnen sehen. Ich kann es natürlich auch nicht genau sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es manchmal an Role-Models fehlt, die jungen Mädels das Gefühl geben, beispielsweise Gitarrespielen geil zu finden. Ich finde es stellenweise schon rätselhaft wo die Klischees schon im jungen Alter herkommen und zum Beispiel junge Mädchen offenbar seltener Lust haben, Schlagzeug oder Gitarre zu spielen.
Du wirkst da aktiv dagegen, indem Du zum Beispiel an einer Mannheimer Kita mit ganz kleinen Kindern verschiedene Genres durchgespielt hast.
Das ist total wichtig. Jetzt habe ich mich zwar gerade mal vermehrt um mein Album gekümmert, aber ich mache so etwas sehr regelmäßig und ich hoffe durchaus, dass ich da bei den Kleinen als Vorbild dienen kann. Ich habe am Heidelberger Karlstorbahnhof ein Projekt namens „push forward“ mit betreut. Eine Art Mentorinnenprogramm. Und abgesehen von der Tatsache, dass die junge Künstlerin, die ich da betreut habe, wahnsinnig cool war, hat das auch mich selbst irre erfüllt. Vielleicht oder hoffentlich braucht diese junge Frau jetzt keine zehn Jahre, um ihr Ding zu machen. Ich habe ihr einfach auch nur gesagt, sich nicht belabern zu lassen …
… vermutlich insbesondere von Männern …
… muss ich leider ja sagen. Weil die Leute, die meine Erfahrung in der Musikindustrie geprägt haben, immer Männer waren, was aber halt auch daran liegt, dass in diesen Strukturen einfach immer noch so viele Männer drinsitzen. Mein allererstes Gespräch bei einem Major war so dermaßen Klischee. Ich erzähle davon aber immer. Verbunden mit dem Rat an junge Frauen, wenn ihnen denn so etwas passiert, einfach aufzustehen und zu gehen. Das habe ich damals einfach nicht hingekriegt. Der Plattentyp hat damals tatsächlich zu mir gesagt, dass ich ja schön groß sei und mal aufstehen und auf und ab laufen solle. So Fleischbeschau. Und ich habe das dann auch, eingeschüchtert wie ich war, tatsächlich gemacht. Aber so etwas geht nicht! Das muss sich niemand gefallen lassen!
Besucht Alex Mayr auf Spotify, Facebook, Instagram und im Web.